Raphael Pesch aus Remagen studiert am Massachusetts Institute of Technology in Boston (MIT) und somit an einer der renommiertesten Hochschulen der Welt
Ein Remagener in Boston
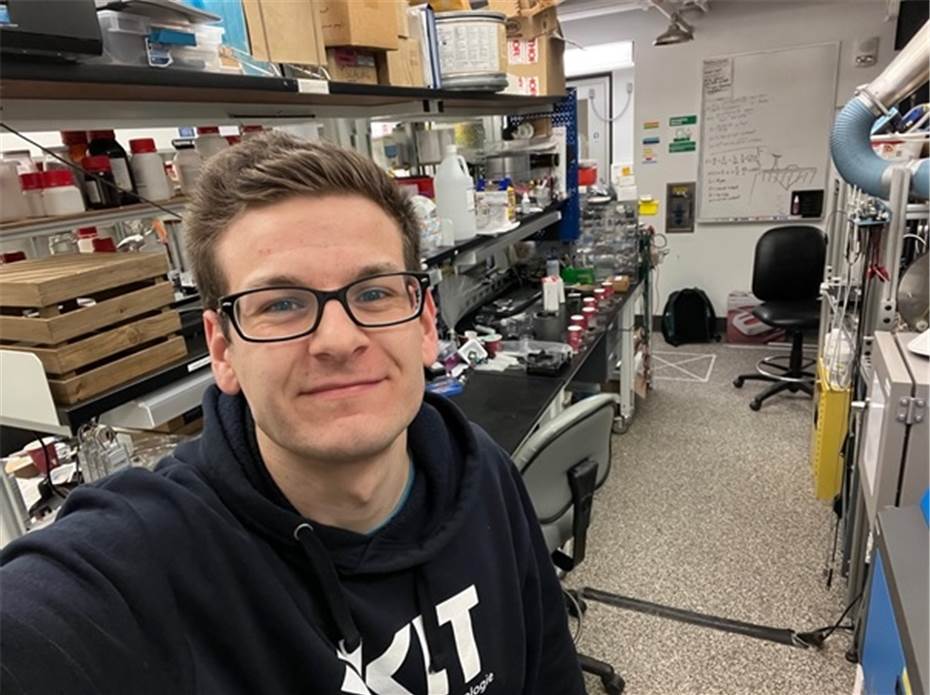
Raphael Pesch ist zum Forschen in den USA. Die meiste Zeit verbringt er in seinem Labor. Foto: privat
Remagen. Der Remagener Raphael Pesch kommt zwar aus einer Hochschulstadt. Aber leider werden wird dort nicht der Studiengang angeboten, der ihn reizte.
Elektro- und Informationstechnik sollte es sein. Deshalb musste er zwecks Masterabschluss über den „großen Teich“, genauer nach Boston an das Massachusetts Institute of Technology. Zuvor studierte er in Karlsruhe. Im Interview mit BLICK aktuell spricht er über das harte Bewerbungsverfahren, das Leben an der Hochschule und die Sichtweise auf die Flutkatastrophe in der Ferne.
BLICK aktuell: Nach dem Studium in Karlsruhe, zieht es Sie zur Masterarbeit in die USA nach Boston, genauer an das hochrenommierte MIT. Warum musste es gerade diese Elite-Hochschule sein?
Raphael Pesch: Zunächst ging es 2016 nach Karlsruhe, da es im näheren Umkreis von Remagen keine technische Universität gab, die Ingenieurswissenschaften anbietet. Das es schlussendlich das KIT in Karlsruhe geworden ist lag vor allem an der guten Wohnungssituation und dem guten Ruf der Universität. Den Schritt zu gehen meine Masterarbeit in Boston am MIT zu schreiben, war zu Beginn gar nicht der Plan. Nach einem einjährigen Industrieaufenthalt bei Porsche in Stuttgart (2019-2020) wollte ich bis zum Ende des Studiums noch einmal die Möglichkeit eines Auslandssemesters nutzen. Nach einem ersten Gespräch mit meinem Professor – Ulrich Lemmer – schlug dieser vor die Masterarbeit im Ausland zu schreiben, da ich dadurch kein Semester „verlieren“ würde und ich parallel zum Auslandsaufenthalt meine letzten Schlüsselpunkte für die Heimatuniversität sammeln könnte. Er schlug mir einige Ort vor an denen er Kontakte hat, darunter vor allem das Palo Alto Research Center, oder die University of California. Mehr oder weniger durch Zufall habe ich entdeckt, dass einer seiner Doktoranden mit dem MIT bereits ein Paper veröffentlicht hat, wodurch ich wusste, dass auch nach dort Kontakt bestehen muss. Zunächst hatte ich Sorgen, es könnte als unrealistische Anfrage direkt abgelehnt werden, doch nachdem ich meinen Professor gefragt hatte, sagte er wir können gerne den Versuch wagen mich als Visiting Student ans MIT zu schicken. Ein Glück wusste ich da noch nicht genau wie aufwendig der Prozess ist, aber am Ende wirklich angenommen worden zu sein, macht die holprige Bewerbungsphase mehr als wett.
BLICK aktuell: Dem Start ging eine über zweijährige Bewerbungsphase voran. Warum dauerte das so lange?
Pesch: Ja, das habe ich mich auch des Öfteren gefragt. Man denkt ja, Deutschland sei für seine Bürokratie bekannt, aber das war dann noch mal ein anderes Level. Drei Faktoren sind da eigentlich maßgeblich. Der erste ist, dass meine Bewerbung genau in die Pandemie fiel und dadurch mehrfach Deadlines verschoben wurden. Das MIT nahm die Pandemie als Anlass das Visiting Student Programm vollständig zu erneuern. Ich habe mich also im Endeffekt durch zwei Bewerbungsprozesse manövrieren müssen, da am Ende des ersten Prozesses gesagt wurde, dass nun neue Regeln gelten und ich noch mal von vorne mit der Bewerbung starten muss. Ich denke also, wenn gerade keine Pandemie ist, kann man auch in drei bis sechs Monaten alles abhaken. Der zweite Faktor sind die recht hohen Hürden. Man braucht zunächst eine/n Professor/in in der Heimat, die/der den ganzen Prozess permanent begleitet und einem einige Gutachten ausstellt. Als nächstes muss ein/e Professor/in am MIT gefunden werden, die/der einen in seiner Forschungsgruppe aufnehmen möchte und ebenfalls bereit ist aus den USA heraus das MIT dazu zu motivieren den Bewerbungsprozess aufzunehmen. Neben zahlreichen Gutachten, Sprachnachweisen und einem Interview, stellt zuletzt auch die Finanzierung eine Hürde da. Das MIT verlangt als private Hochschule recht hohe Studiengebühren. Um sicher zu stellen, dass man sich damit jedoch nicht verschuldet und dass auch externe Parteien an die Leistungen der Studierenden glauben, verlangt das MIT, dass mindestens 51% dieser Kosten durch Stipendien fremdfinanziert sind. Man muss sich also neben der Bewerbung am MIT auch noch um Bewerbungen für Stipendien kümmern und versuchen möglichst viele Gelder von Stiftungen zu organisieren. Dabei ist oft das „Henne-Ei-Problem“ zu überwinden: Das MIT verlangt einen Nachweis über Sponsoring, um den Studienplatz zu bekommen und die meisten Sponsoren verlangen einen Nachweis darüber, dass man den Studienplatz am MIT schon hat, um die Förderung zu erhalten. Das ist oft ein nervenaufreibender Prozess.
Zuletzt spielt einem die Zeitverschiebung schlecht in die Karten. Meistens kommen E-Mails aus den USA am späten Abend, oder gar nachts an, weshalb man sich für zeitkritische Formulare oft auch nach dem Arbeitstag noch in eine nächtliche „Bürokratieschlacht“ begeben muss. Leider pausiert das „normale“ Masterstudium tagsüber parallel zur Bewerbung nicht. Als die Bewerbungsphase endlich überstanden war, war ich auf alle Fälle sehr froh. Ich habe mal nachgezählt und kam auf insgesamt über 280 E-Mails die ich hin und her geschrieben in den 2 Jahren.
BLICK aktuell: Nach dem Master am MIT gelten Sie als hoch qualifiziert – welchen Beruf streben Sie an und wo?
Pesch: Ich bin zum Forschen ans MIT gekommen. Licht hat mich schon seit der Schulzeit fasziniert, um so schöner war es, dass ich mich als Elektroingenieur im Bereich der „Mikro-, Nano- und Optoelektronik“ spezialisieren konnte. Licht von Grund auf zu verstehen, die Wellen-, sowie Teilcheneigenschaften ausnutzen zu können und durch gezielte Manipulation von Materialien nützliche Produkte zu entwickeln ist sehr spannend. Aktuell tendiere ich dazu, nach der Masterarbeit noch auf eine Promotion hin zu arbeiten, die ich gerne mit einem MBA verknüpfen würde. Langfristig möchte ich allerdings anwendungsbezogener arbeiten und in die Industrie wechseln. Deutschland hat wirklich viel zu bieten in dem Fachbereich. Sei es Osram, Phytonics, Schott, Zeiss, oder die Automobilindustrie: Auswahl gibt es genug. An einen festen Ort bin ich nicht gebunden, das Rheinland als Heimat ist aber natürlich attraktiv.
BLICK aktuell: Das Hochschul-Leben unterscheidet sich sicher von dem in Deutschland. Wie gestaltet sich Ihr Alltag?
Pesch: Da ich hier „nur“ zum Forschen bin, bekomme ich gar nicht so viel vom Hochschulalltag mit. Den Großteil meiner Zeit stehe ich im Labor und hantiere mit Chemikalien oder optischen Bauteilen herum. Mein Supervisor hier hat eine weiche-polymerbasierte Haut entwickelt, welche bei Dehnung ihre Farbe verändert. Ich versuche diese derzeit als Sensor für verschiedenen Anwendungen zu implementieren. Nichtsdestotrotz versuche ich interessenshalber auch die ein oder andere Vorlesung zu besuchen, sodass ich auch einen Einblick in das studentische Leben bekomme. Ein großer Unterschied zwischen dem MIT und Universitäten in Deutschland sind die Studiengebühren. Ich bin froh, dass diese in Deutschland für europäische Studierende nicht anfallen. Dennoch haben die Studiengebühren auch einen witzigen Effekt zur Folge. Hier in den USA werden die Studierenden mehr wie Kunden behandelt. Dadurch, dass sie für die Lehre mehr oder weniger direkt selbst zahlen, setzt die Universität auch alles daran, dass alle Studierenden so viel Hilfe wie möglich bekommen. In Deutschland muss man sich, vor allem im Grundlagenstudium erst einmal selbst zurechtfinden und durchbeißen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die Studiengebühren sind aber zumindest für mich ein No-Go-Argument für ein „volles“ Studium in den USA / am MIT.
BLICK aktuell: Sie kommen aus dem Kreis Ahrweiler. Wie betrachten Sie in die Entwicklungen aus der Ferne zum Thema Flutkatastrophe?
Pesch: Zunächst kann ich mich unglaublich glücklich schätzen, dass ich die Flut und die ersten Tage nach der Flut „nur“ aus der Ferne miterlebt habe. Dennoch erinnere ich mich noch ziemlich gut an den Morgen nach der Flut. Meine Mutter arbeitet in Ahrweiler und meine Eltern leben in Remagen. Remagen selbst ist zum Glück nicht betroffen, aber die ersten Tage gab es auch dort keinen Strom, weshalb der Kontakt in die Heimat ziemlich schwer herzustellen war. Vor allem die ersten Stunden in denen noch kaum bekannt war, wie die Lage war, waren wirklich nervenaufreibend. Meine Mutter hat mich mit häufig abreißender Verbindung anrufen können und gefragt, ob ich herausfinden kann, ob die Steinbachtalsperre gebrochen sei. Am Anfang war es wirklich sehr chaotisch, aber auch nachdem die ersten Bilder und dadurch die Ausmaße zu sehen waren, war ich ziemlich schockiert. Auch bei meinem ersten Besuch nach der Flut in der Heimat konnte ich noch nicht wirklich fassen was passiert ist. Ich habe 2014 meinen Führerschein beim TÜV in Sinzig gemacht und als ich dort nun vorbeifuhr, war kaum mehr etwas wiederzuerkennen. An Heiligabend haben wir als Familie meine Mutter von der Arbeit in Ahrweiler abgeholt. Das Ausmaß der Zerstörung auch Monate nach der Flut ist einfach unfassbar.
Was mir aber vor allem im Kopf bleiben wird, sind die Bilder von hunderten, ja gar tausenden freiwilligen Helfer/innen aus ganz Deutschland, die Tage und Nächte im Schlamm standen und mitgeholfen haben, die Region um die Ahr wieder aufzuräumen. An jedem noch so kleinen Ort hängen Schilder von dankbaren Menschen, die überwältigt waren von der Hilfsbereitschaft. Der Zusammenhalt, den man vor Ort, aber auch in den Nachrichten mitbekommen hat, macht mich sehr glücklich und dankbar. Es ist schön so viel Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft zu sehen. ROB