Von der Aufklärung bis zur Naziherrschaft:
Neues über rheinische Weinbauvereine
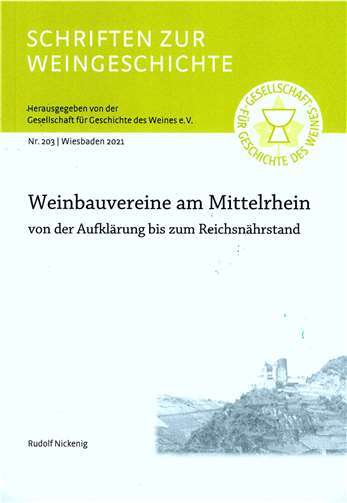
Kreis Ahrweiler. Der Autor, der selbst einer Winzerfamilie aus Boppard am Mittelrhein entstammt, hat sich in dieser Schrift eines Anbaugebietes angenommen, dessen heutige Grenzen jüngeren Datums sind. „Diese ‚Eindeutigkeit‘ eines abgegrenzten Weinbaugebietes gab es frühestens seit 1936, als die Rebflächen am Mittelrhein bereits auf ein Drittel des ursprünglichen Umfangs zurückgegangen waren. Kein Wunder, dass in der frühen Entstehungszeit der Weinbauvereine im 19. Jahrhundert die territoriale Zuordnung der Weinbauvereine, insbesondere in Gebieten mit wechselnden politischen und verwaltungsmäßigen Grenzen, nicht einfach war“, stellt Nickenig mit Blick auf das oft diskutierte, lange Zeit schwach ausgeprägte Zusammengehörigkeitsgefühl am Mittelrhein fest. Er schildert eindrücklich die Geschichte der berufsständischen Organisationen als Kampf gegen den drohenden Untergang einer einmaligen Weinlandschaft, die heute teilweise als Weltkulturerbe eingestuft ist.
Einer ausführlichen Darstellung der historischen Verwaltungsstrukturen folgt die Beschreibung der frühen weinbaulichen Organisationsideen, die insbesondere von den Wander-Versammlungen der Weinproduzenten zu Beginn des 19. Jahrhunderts initiiert und forciert wurden. So entstanden die ersten landwirtschaftlichen Organisationen mit weinbaulichen Untergliederungen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Erst im beginnenden 20. Jahrhundert bildeten sich die regionalen Weinbauvereine für das Siebengebirge, den Kreis Neuwied, Rhein-Ahr, die rechte Seite des oberen Mittelrheins und den Mittelrheinischen Weinbauverein auf der linken oberen Mittelrheinseite, eingebunden in überregionale Strukturen wie den Rheinischen Winzerverein, den Preußischen und den Deutschen Weinbauverband. Der Autor beschreibt nicht nur die Entwicklung der Organisationen, sondern auch der korrespondierenden weinwirtschaftlichen Strukturen anhand von tabellarischen Übersichten und die wichtigsten Themenfelder und Vereinstätigkeiten im Laufe ihrer Verbandsgeschichte.
Mit dem Gleichschaltungsgesetz der NS-Führung wurden alle landwirtschaftlichen Organisationen aufgelöst und damit auch die Weinbauvereine entmachtet. Damit war das vorläufige Ende der freien Berufsvertretungen Weinbauvereine besiegelt. In einem Epilog wird in kurzen Zügen die Entwicklung nach 1945 dargestellt bis hin zur Gründung des Weinbauverbandes Mittelrhein im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V. Zusammenfassend ist festzuhalten: Der Autor schildert das Auf und Ab der Interessensvertretungen rechts und links des Rheins von der Kaiserzeit bis zu ihrer Auflösung durch die Nationalsozialisten. Treiber der Vereinsgründungen war ein verzweifelter Kampf gegen politische, handels- und wirtschaftspolitische und klimatische Rahmenbedingungen, aus denen die Winzer am Mittelrhein oft als Verlierer hervorgingen. Der Autor blickt mit einem begründeten Optimismus in die Zukunft eines Gebiets, das durchaus berechtigt zum Weltkulturerbe zählt, vor allem aber über ein hohes Qualitätspotential für zukünftige Winzergenerationen verfügt. Die Schrift Nr. 203 „Weinbauvereine am Mittelrhein“ kann bei der Gesellschaft für Geschichte des Weines für 12 Euro bestellt werden.
Rudolf Nickenig: Weinbauvereine am Mittelrhein von der Aufklärung bis zum Reichsnährstand (Schrift Nr. 203 der Gesellschaft für Geschichte des Weines).









