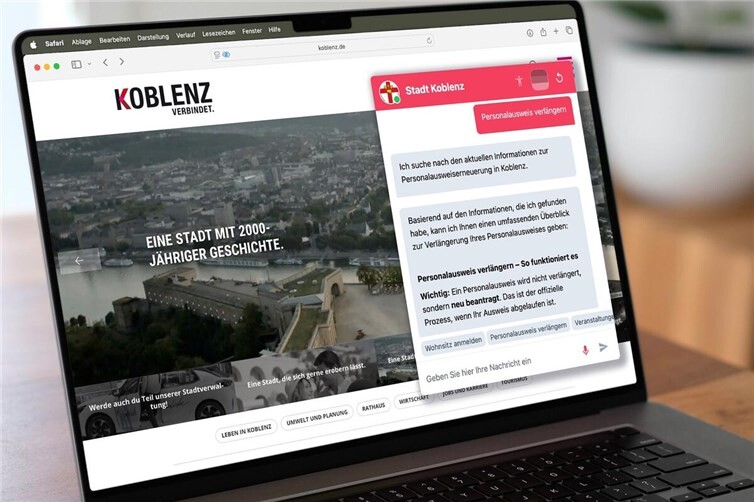Heutzutage kurios erscheinende Regelungen und Ansichten
Als Verlobung und Kranzgeld noch im Gerede waren
Region. Es ist heute fast schon schick, einen Blick zurück auf die Lebensverhältnisse und Ereignisse in der Zeit vor 50 und noch mehr Jahren zu werfen. Dies soll hier einmal getan werden - in Bezug auf die Folgen der Heirat für eine Ehefrau und die Verhältnisse von Mann und Frau in der Zeit kurz vor einer Heirat.
Es war die Zeit, als die gesellschaftlichen Moralvorstellungen noch weitgehend den christlichen Moralvorstellungen entsprachen.
Es war auch die Zeit der Geltung eines rigiden patriarchalen Familienrechts, nach dem der Mann zum natürlichen „Oberhaupt“ der Familie mit weitgehenden Vollmachten, auch gegenüber seiner Ehefrau, ausgestattet war.
Unter Berücksichtigung dieser gesellschaftlichen Umstände sind auch manche der folgenden gesetzlichen Regelungen zu verstehen. Diese Umstände haben auch zu manchen Reaktionen der Bevölkerung geführt, die uns heute als seltsam erscheinen.
Kuppelparagraf
Es ist noch gar nicht so lange her, dass es bei uns einen so genannten „Kuppelparagrafen“ gab. Es war die alte Fassung von § 180 Strafprozessordnung (StPO).
Danach war mit Kuppelei die Vermittlung von Gelegenheiten zur sogenannten Unzucht gemeint. Wegen „Kuppelei“ konnte eine Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren verhängt werden.
Aus Angst, mit dem Vorwurf der „Kuppelei“ konfrontiert zu werden, vermieteten zum Beispiel viele Eigentümer ihre Wohnungen oder Studentenzimmer keinesfalls an unverheiratete Paare, von verheirateten Paaren wurde die Vorlage des Trauscheins verlangt. Um ein Hotelzimmer zu mieten, gaben sich unverheiratete Paare als Ehepaare aus.
In der Verwandtschaft waren zwei Tanten, die hatten ein Fremdenzimmer an einen Junggesellen vermietet.
Wenn der schon mal Damenbesuch bekam, achteten die beiden Damen genau darauf, dass der weibliche Besuch bis spätestens 22 Uhr das Haus verließ. Warum fing erst nach 22 Uhr bei denen das Kuppeln an?
Der Paragraf 180 StGB wurde 1973 in „Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger“ gewandelt.
Wilde Ehe
Bei dieser Gesetzeslage, das heißt innerhalb der Geltung des Kuppelparagrafen, war auch das Zusammenleben eines unverheirateten Paares, die sogenannte „wilde Ehe“ fast völlig unmöglich.
Es war nicht verheirateten Paaren beispielsweise unmöglich, eine gemeinsame Wohnung zu mieten. Diese Lebensweise wurde als schwer sündhaft angesehen und kam fast einem Verbrechen gleich. Der etwas veraltete Ausdruck „wilde Ehe“ spiegelt somit auch die Einstellung der Gesellschaft gegenüber der eheähnlichen Lebensgemeinschaft bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wider.
Heute ist unter der wilden Ehe lediglich das Zusammenleben zweier Partner in einer gemeinsamen Wohnung zu verstehen, ohne dass beide miteinander verheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind.
Vergleich der Verlobung mit einem Kinderfahrrädchen
Heute nur noch selten von zwei Verliebten praktiziert ist die Verlobung oder das Verlöbnis. Es ist das Versprechen, eine Person (den Verlobten beziehungsweise die Verlobte) zu heiraten. Dies geschah oft in feierlicher Form im Kreis der nächsten Angehörigen. Zum Zeichen der Verbundenheit schenkten sich die Verlobten gegenseitig einen Verlobungsring, der bis zur Hochzeit links, danach an der rechten Hand getragen wurde.
Jemand hat einmal die Verlobung mit einem kleinen Kind verglichen, dem ein Fahrrädchen mit dem Hinweis geschenkt wird: Klingeln darfst du, fahren aber noch nicht. Heute kommt eine Verlobung mit Anzeige in der Zeitung nur noch ganz selten vor, weil, um im Bild mit dem Rädchen zu bleiben, jede(r) schon immer klingeln und fahren darf.
Aus einem Verlöbnis konnte nicht auf Eingehen einer Ehe geklagt werden. (§ 1297 Abs. 1 BGB) Die Auflösung eines Verlöbnisses konnte nur zu Schadenersatzansprüchen führen.
Kranzgeld
Am Ende seines Daseins als kurios empfunden war auch der § 1300 BGB, der sogenannte Kranzgeldparagraf. Danach konnte eine „unbescholtene“ Frau, die ihrem Verlobten die Beiwohnung gestattete, wenn der Verlobte vom Verlöbnis zurückgetreten war oder schuldhaft den Rücktritt der Verlobten veranlasst hatte, von ihrem ehemaligen Verlobten eine billige Entschädigung in Geld verlangen.
Begründet wurde die Regelung dieses Paragrafen unter anderem mit der Vermutung, dass eine vom Verlobten bereits Verführte später weniger Chancen auf dem Heiratsmarkt habe. Als nicht mehr zeitgemäß wurde § 1300 BGB mit Wirkung vom 1. Juli 1998 aufgehoben und aus dem BGB gestrichen.
Voreheliche Schwangerschaft: Eheschließung oft außerorts
Als die voreheliche Schwangerschaft von der Bevölkerung kommentiert wurde mit: „Da ist die Frau auch schon schwanger, die müssen aber jetzt heiraten“, war für die Allgemeinheit nicht mehr der voreheliche Geschlechtsverkehr verwerflich, sondern die mögliche uneheliche Geburt des Kindes.
Um dem Gerede der Nachbarschaft zu entgehen, heirateten viele Paare, bei denen die Frau schwanger war, nicht kirchlich am Ort, sondern in Remagen auf dem Apollinarisberg. Der Apollinarisberg war so der Heiratsort schwangerer Paare aus der Umgebung.
Das ist heute noch in den alten Heiratsbüchern des Klosters nachzulesen. Auch dieser Umstand wurde mit den Worten: „Die haben in Remagen auf dem Berg geheiratet, da war die Braut sicher schon schwanger“ kommentiert. Allen dort Getrauten wurde quasi im Gerede der Bevölkerung eine Schwangerschaft unterstellt.
Glaubensverschiedene Ehen
Noch vor nicht allzu langer Zeit war es bei manchen katholischen Familien verpönt, dass eine Tochter oder ein Sohn ein Verhältnis mit einer/einem dem evangelischen Glauben Angehörenden unterhielt. Wenn dann auch noch evangelisch geheiratet und die Kinder evangelisch getauft wurden, führte dies oft zur Verstimmung in der katholischen Familie.
Dass die Religionszugehörigkeit auch bei der Generation unserer Großeltern noch von großer Bedeutung bei der Partnerwahl war, konnte meine Tochter noch erfahren.
Als sie nämlich im Juni 2008 ihrer 94-jährigen Großmutter erklärte, dass sie im nächsten Jahr zu heiraten gedenke, war die erste Frage der Großmutter, die den Bräutigam noch nicht kannte: „Ist er denn katholisch?“. Als dies bejaht wurde, war die Sympathie der Großmutter für das neue Familienmitglied hergestellt.
Familienname bei der Heirat
Erst nach Inkrafttreten des Bügerlichen Gesetzbuches (BGB) zum 1. Januar 1900 erhielt eine Frau mit ihrer Heirat den Familiennamen des Mannes als Ehenamen. In der Zeit davor behielt die Frau ihren angeborenen Familiennamen auch noch nach einer Heirat.
Deshalb ist in Kirchen- und Standesamtsbüchern bei verheirateten Frauen oft hinter dem Geburts-/ Familiennamen vermerkt: dicta (das heißt genannt) ... und hier ist dann der Familienname des Ehemannes angegeben. Hier ist die Allgemeinheit der späteren gesetzlichen Regelung schon vorausgeeilt.
Bis heute hat sich die einschlägige Rechtslage wiederholt geändert, sodass jetzt Eheleute unter mehreren Möglichkeiten ihren Familiennamen auswählen können.
Erwerbstätigkeit der Ehefrau nur mit Zustimmung des Ehemannes
Die Berufsfreiheit ist das Grundrecht (Art. 12 Abs. 1 GG), seinen Beruf frei zu wählen und auszuüben. Diese Berufsfreiheit endete einmal mit der Eheschließung. Ab diesem Zeitpunkt konnte eine Ehefrau nur noch mit Zustimmung ihres Ehemannes arbeiten gehen. (§ 1358 BGB).
Diese Beschränkung wurde erst mit Wirkung vom 1. Juli 1958 außer Kraft gesetzt. (Gleichberechtigungsgesetz vom 18. Juni 1957).
Die Beschränkung der Selbstständigkeit der Ehefrau stand nicht nur auf dem Papier, sondern bedeutete für manche Ehefrau nach ihrer Heirat das Ende ihrer Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis außerhalb des eigenen Haushalts. Eine ältere Frau, die bei einer Sinziger Firma beschäftigt war, erzählte, dass sie nach ihrer Heirat diese Tätigkeit auf Betreiben ihres Ehemannes aufgeben musste, da dieser hiermit nicht einverstanden war. Sein Argument: „Wenn du weiter arbeiten gehst, denken die Leute, ich könnte mit meinem Lohn nicht meine Familie ernähren.“ So wie dieser Frau wird es auch noch vielen anderen Frauen nach ihrer Heirat ergangen sein.
Lange Hosen bei Frauen
Bis Anfang der 1960er Jahre war bei Frauen das Tragen von langen Hosen noch nicht allgemein akzeptiert. Ich habe 1958 erlebt, dass weibliche Bedienstete bei der Kreisverwaltung Ahrweiler nur im Rock am Arbeitsplatz erscheinen durften. Das bedeutete im Winter für zwei Frauen, die morgens mit dem Zug von Remagen nach Ahrweiler kamen und wegen der Kälte auf den Bahnhöfen lange Hosen anhatten, dass sie sich morgens auf der Toilette umziehen mussten, um im Rock im Büro zu erscheinen.
1968 wurde plötzlich alles anders. Wer sich erinnert: 1968 war unter anderem das Jahr, das die sogenannte sexuelle Revolution einleitete. Am 1. Juni 1961 war die erste Antibabypille auf den deutschen Markt gekommen.
1968 rebellierte die junge Generation unter anderem gegen die überkommenen Moralvorstellungen der Erwachsenenwelt.
Damit begann eine Liberalisierung in der Sexualmoral, und die bis dahin geltenden Moralvorstellungen fanden in der Bevölkerung immer weniger Beachtung. Auch die Gleichberechtigung hat dafür gesorgt, dass die Rechte der Frauen immer mehr Geltung bekamen. Und das war gut so.
Hans Josef Moeren