
Am 20.04.2016
Allgemeine BerichteAhrWeinForum
Gab es in der Römerzeit einen genagelten Hufbeschlag?
Heimatforscher und Buchautor Gerd Otto trat mit interessanten Thesen den Beweis an
Ahrweiler. Wenn auch die Frage, ob es im alten Rom genagelten Hufbeschlag beziehungsweise Hufeisen gab, zu keiner Zeit eine „weltbewegende Bedeutung“ hatte, so wird dieses Thema in Fachkreisen schon seit jeher äußerst kontrovers und mitunter leidenschaftlich diskutiert.
Während in den Kreisen der Archäologen die Meinung vorherrscht, dass es zur Römerzeit keinen genagelten Hufbeschlag gegeben haben soll, vertritt der aus Wehr stammende Heimatforscher und Buchautor Gerd Otto („Auf den Spuren der Römer in der Osteifel“) nach vielen Jahren intensiver Recherche den Standpunkt, dass während der Römerzeit sowohl Pferde als auch Ochsen und Maultiere beschlagen wurden.
In einem geradezu erfrischend aufrichtigen Vortrag, in dessen Verlauf er sich auf Fachliteratur wie die Bonner Jahrbücher oder den Saalburg-Bericht des Baumeisters Louis Jacobi aus dem Jahr 1897 bezog, trug Otto einige seiner durchaus schlüssigen Thesen vor, die seine Ansicht nicht nur untermauerten, sondern auch die anwesenden Gäste der Veranstaltung nachdenklich stimmten.
Bei Grabung gefundene Hufeisen sind verschwunden
Otto wies zum Beispiel auf die Aussage von Louis Jacobi hin, dass bei Grabungen im Umfeld der Saalburg unter anderem auch in dem eingetrockneten Brunnenschlamm der ungefähr 40 Brunnen sowie in dem untersten Zerstörungs- und Brandhorizont etwa 100 Hufeisen im Gemenge mit vielen weiteren als römisch relevant datierten Gegenständen zutage gefördert wurden. Dazu präsentierte er den mit entsprechenden Fotos dokumentierten Bericht von Louis Jacobi, der in dem 1897 erschienenen Buch „Das Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe“ nachzulesen ist. „Merkwürdigerweise findet man heute in den Vitrinen der Saalburg zwar das gesamte Fundgut, allerdings sind die Hufeisen nicht mehr dabei“, so der Heimatforscher Gerd Otto, der in diesem Zusammenhang auch den Anthropologen und Archäologen Prof. Hermann Schaaffhausen zitierte, der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck brachte, es sei unstatthaft, aus einem geschlossenen archäologischen Befund auch nur einen Gegenstand herauszunehmen und separat zu beurteilen, weil dadurch die Gesamtaussage verfälscht werde. Dieser Aussage hatten sich seinerzeit die in Fachkreisen durchaus bekannten Archäologen Gustav Kossinna und Herbert Jankuhn im Zusammenhang mit der „modernen Siedlungsarchäologie“ angeschlossen.
Behauptung unkritisch übernommen
Otto vertrat weiter seine feste Überzeugung, dass die vor vielen Jahren aufgestellte Behauptung, es habe in der Römerzeit keinen Hufbeschlag gegeben, von den Archäologen unkritisch übernommen und als unumstößliche Lehrmeinung weiter verbreitet wurde. Hierzu stellte eine Besucherin der Veranstaltung trocken fest, dies erinnere sie an die vor vielen Jahren aufgestellte Behauptung, dass Spinat besonders eisenhaltig sei. „Über viele Generationen hinweg wurden aufgrund dieser Aussage die Kleinkinder mit Spinat gefüttert, was zwar keinem Kind geschadet hat, aber aufgrund der inzwischen von der Wissenschaft widerlegten These auch keinem Kind etwas genützt hat“, so die Besucherin. Museumsleiter Dr. Hubertus Ritzdorf erklärte, dass die Archäologie vor langer Zeit in der philosophischen Fakultät angesiedelt war und heute immer mehr der Naturwissenschaft zugeordnet werde, da sie sich immer mehr naturwissenschaftlicher Hilfsmittel bediene. Allerdings handele es sich bei der Archäologie keinesfalls um eine Naturwissenschaft, da hier im Gegensatz zur Archäologie jedes einzelne Experiment - ähnlich einem Rezept - an jedem Ort der Welt nachgestellt werden könne. Dennoch müsse man bei der Archäologie eine Ausgrabungsstelle genauestens und unvoreingenommen dokumentieren, ungeachtet dessen, ob man jedes einzelne Teil für relevant halte oder nicht.
Im Rahmen der von Dr. Ritzdorf initiierten Vortragsserie wird Werner Jahr am 1. Juni um 19 Uhr über das Thema „Die Wasserversorgung der Römer“ sprechen. FRE
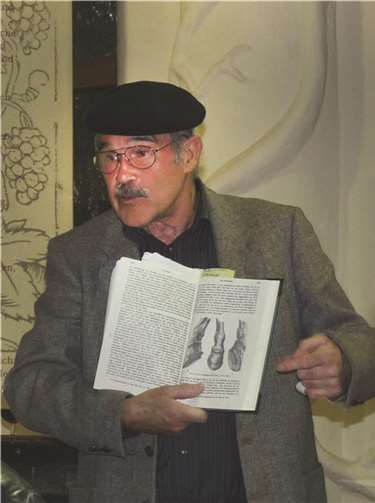
Der Heimatforscher und Autor Gerd Otto untermauerte seine Thesen unter anderem auch anhand des Saalburg-Berichtes von Louis Jacobi.









